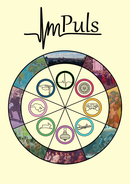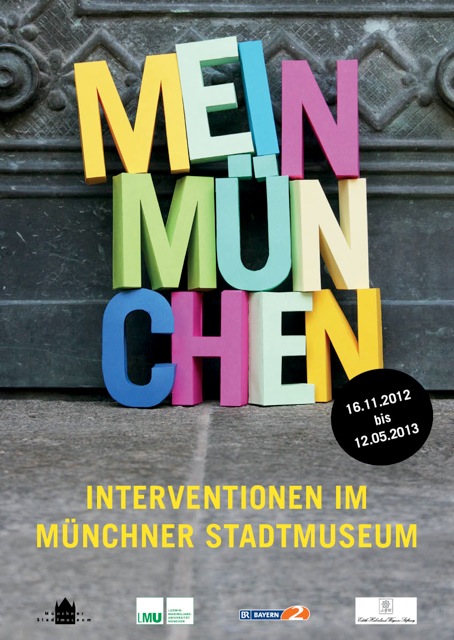Lernforschungsprojekte
Gerade für eine Disziplin wie die Empirische Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie, die mit ihrem breiten kulturwissenschaftlichen Spektrum für keine klar definierten Berufe ausbildet, stellt das so genannte Lernforschungsprojekt die beste Möglichkeit dar, Studierende auf die zukünftige Berufswelt vorzubereiten.
Beim Lernforschungsprojekt lernen Studierende von der Pike auf, ein wissenschaftliches Projekt durchzuführen. Sie arbeiten am Projektentwurf, entwickeln ein Forschungsdesign und wählen die entsprechenden Methoden, vertiefen die notwendigen theoretischen Erkenntnisse, gewinnen die empirischen Ergebnisse (durch qualitative aber auch quantitative Methoden, in Feldforschung oder durch Archivrecherchen etc.) und schließen diese Forschungen durch eine Publikation (oder auch durch eine Ausstellung, einen Film, eine CD-Rom) ab. Maßgeblich ist dabei nicht nur die wissenschaftliche Qualifizierung, sondern das Erlernen jener soft skills, die heute in fast allen Berufsfeldern von Akademikerinnen und Akademikern von Bedeutung sind: Kommunikation, Recherche, Präsentation, Flexibilität und Kreativität.
Dazu kommt, dass der Kontakt zwischen Studierenden und Dozierenden beim Lernforschungsprojekt viel enger ist als in der sonstigen Lehre, wodurch eine intensivere Auseinandersetzung mit Inhalten aber auch eine Berücksichtigung persönlicher Interessen, eine gezielte Förderung von Stärken und ein Beheben von Defiziten möglich wird. Ein positiver Nebeneffekt des Lernforschungsprojekts liegt in der Vorbereitung auf den Studienabschluss: Wer ein Lernforschungsprojekt erfolgreich absolviert hat, hat keine Schwierigkeiten mit einer Masterarbeit und beendet auch sein Studium mit Erfolg.
Das aktuelle Lernforschungsprojekt im Sommersemster 2025 und Wintersemester 2025/2026 wird zum Thema "Stadt im Werden. Ethnografische Perspektiven auf ein Münchner Neubauquartier" unter der Leitung von Dr. Laura Gozzer stattfinden.
-
Trümmerzeit. Eine alltagsgeschichtliche Spurensuche in München 1945-1955
-
Sommerstraße, Schanigarten, Lastenfahrrad, SUV. Urbane Konflikte um Raumnutzung und Mobilität im Kontext der 'Verkehrswende
-
Alltagskultur im Wandel: Ethnografische Perspektiven auf Transformationsprozesse in ländlichen Räumen in Bayern
-
Wem gehört der Berg? Nutzungskonflikte, symbolische Kämpfe und moralische Setzungen im alpinen Raum
-
Lokale feministische Bewegungen - Akteur*innen, Räume, Praktiken und Diskurse in München
-
Unterstützen, Helfen, Solidarisieren ‒ Ethnographien des Karitativen
-
Alpine Lebenswelten, Perspektiven, Situationen (ALPS)
-
Jugendszenen in München. Ethnografische Perspektiven auf jugendkulturelle Räume und Praxen in urbanen Milieus
-
München versicherheitlicht
-
Prekärer Ruhestand. Ist Altersarmut weiblich?
-
Leerstellen des Zweiten Weltkriegs in München und Umgebung. Eine virtuelle Ausstellung
-
Governing Migration
-
The “feel-good” city: Politics and Places of Wellbeing, SoSe2014
-
Jüdisches Europa heute
-
Die populäre Kultur und der Staat
-
Mein München: Studentisches Ausstellungsprojekt im Stadtmuseum
-
Mobile Arbeit
-
München-Tourismus.Eine Stadt als Destination
-
Sounds like Munich. Vom Klang der Stadt
-
Spätmoderne Arbeits- und Lebenswelten
-
München migrantisch - migrantisches München
-
München stadtanthroplogisch untersucht